Dienstag, 5. August 2008
Im Kino: The Dark Knight
am Dienstag, 5. August 2008, 14:13 im Topic 'Filmkritiken'
 Seit Ahab sein Bein hatte verlieren muessen, sind koerperliche Verstuemellungen ja ein absoluter Standard bei den grossen Wahnsinnigen der Literatur- und Filmgeschichte und so muss natuerlich auch der absolut wahnsinnige Joker im neuesten Batman-Streifen eine gruselige Narbe besitzen. Die Macher haben sich hier vielleicht bei "Pans Labyrinth" inspirieren lassen, dem Boesewicht werden hier naemlich genau wie dem Joker in seiner Kindheit die Mundwinkel aufgeschlitzt. Und deswegen muss der enstellte Joker nun immer mit grotesk verlaufenem Make-Up sein Unwesen treiben und die Haare waescht er sich auch eher ungern. Trotzdem ist der Joker eine sehr interessante Figur geblieben und wenn er in der hellen Verhoerzelle sitzt, dann sieht er auch gar nicht mehr so angsteinfloessend aus. Der mittlerweile verstorbene Heath Ledger spielt den Joker wie erwartet grossartig, eigentlich sogar besser als Jack Nicholson im Burton-Batman, denn der Joker besitzt als Figur echte Tiefe. Auch wenn die Geschichte mit dem Kindheitstrauma vielleicht nicht sehr originell ist, die Figur funktioniert in ihrer Aufgabe perfekt.
Seit Ahab sein Bein hatte verlieren muessen, sind koerperliche Verstuemellungen ja ein absoluter Standard bei den grossen Wahnsinnigen der Literatur- und Filmgeschichte und so muss natuerlich auch der absolut wahnsinnige Joker im neuesten Batman-Streifen eine gruselige Narbe besitzen. Die Macher haben sich hier vielleicht bei "Pans Labyrinth" inspirieren lassen, dem Boesewicht werden hier naemlich genau wie dem Joker in seiner Kindheit die Mundwinkel aufgeschlitzt. Und deswegen muss der enstellte Joker nun immer mit grotesk verlaufenem Make-Up sein Unwesen treiben und die Haare waescht er sich auch eher ungern. Trotzdem ist der Joker eine sehr interessante Figur geblieben und wenn er in der hellen Verhoerzelle sitzt, dann sieht er auch gar nicht mehr so angsteinfloessend aus. Der mittlerweile verstorbene Heath Ledger spielt den Joker wie erwartet grossartig, eigentlich sogar besser als Jack Nicholson im Burton-Batman, denn der Joker besitzt als Figur echte Tiefe. Auch wenn die Geschichte mit dem Kindheitstrauma vielleicht nicht sehr originell ist, die Figur funktioniert in ihrer Aufgabe perfekt.Was den Film ausser seinem grossartigen Boesewicht noch auszeichnet ist die superheldenuntypische Inszenierung. Es wird auf Humor fast durchgehend verzichtet, der Film setzt auf groesstmoegliche Duesternis, aber das passt ja schliesslich gut zu Batmans Charakter. Die Inszenierung ist nicht nur duester, sondern auch sehr bodenstaendig und realistisch. Der Film beginnt mit einem verwirrenden Bankueberfall, bei dem sich die als Joker verkleideten Bankraeuber fast gaenzlich selber ausloeschen. Auch der Rest des Films verzichtet auf abgehobene Actionszenen, sondern ist so spannend inszeniert wie ein klassischer Thriller. Auch die Actionszenen sind immer realistisch, denn wie man verlauten liess, wurde auch meistens auf Computerunterstuetzung verzichtet. Deswegen ist die Action hoffentlich wegweisend fuer einen neuen Realismus im Actionkino. Erstaunlicherweise hat man sich auch gegen den Trend der Wackelkamera entschieden und entwickelt lieber eine subtilere Spannung. Der Film ist zwar schnell, man wechselt im Minutentakt die Orte des Geschehens, doch nie zu hektisch. Leider sind durch das zu volle Drehbuch und die vielen Ortswechsel die Figuren auf der Strecke geblieben. Maggie Gyllenhall spielt toll, aber die Figur ist ziemlich bieder, genau wie der Rest der Hauptfiguren, die allesamt nicht wirklich Tiefe haben. Das tut der Spannung aber keinen Abbruch.
Der Realismus in den knalligen Sequenzen spiegelt aber auch wieder, dass der Film offensichtlich mit den Aengsten der Zuschauer spielt. Der Joker unterscheidet sich zwar in seinem grenzenlosem Nihilismus klar von den islamistischen Terrorgruppen, aber auch er will die zivilisierte westliche Welt mit ihren eigenen Waffen ins totale Chaos stuerzen. Und das mit teilweise grossem Erfolg. Den Einbruch des Chaos hat man im Film in Szenen festgehalten, die zu den Besten des Films gehoeren. So wird eine Polizeiveranstaltung schnell zur Massenpanik und zeigt dass wir unser groesster Feind sind. Auch sonst ist die Story zwar viel zu vollgestopft, aber auf ihre Weise doch glaubhaft. Und so touchiert der Film seine teilweise sehr grosse Einfallslosigkeit erfolgreich damit, dass es einem dauerhaft so vorkommt, man wuerde etwas sehr Relevantes sehen. Und so sind die ersten zwei Stunden wirklich extrem spannend, duester und packend, aber irgendwann ueberspannt der Film seinen Spannungsbogenzu weit. Schlimm ist es auch, dass der Film zum Ende hin immer mehr die Pfade der spannenden Inszenierung verlaesst und zum hektischen BummBumm-Actionspektakel wird. Es stellt sich eine Art Uebersaettigung ein, wenn schliesslich noch ein Gegenspieler Batmans, natuerlich frueher einer seiner groessten Unterstuetzer, eingebaut wird. Und so ist man dann doch etwas enttauscht, dass der Film zum Ende hin so schlecht wurde, aber einer der intelligentesten Blockbuster ist er wahrscheinlich trotzdem, da noch nie so glaubwuerdig die Zerbrechlichkeit und Schwaeche der "zivilisierten" Welt dargestellt wurde. Und dass noch die Beziehung zwischen dem Joker und Batman, die ja doch recht komplex ist, hier eine grosse Rolle spielt, macht den Film dann noch spannender.
Permalink (9 Kommentare) Kommentieren
Sonntag, 20. Juli 2008
Im Kino: Dainipponjin (Der große Japaner)
am Sonntag, 20. Juli 2008, 19:35 im Topic 'Filmkritiken'
 Es wirkt ja fast ein bisschen kalkuliert, dass nach dem Erfolg von Will Smith´s "Hancock" nun noch ein ungeliebter Superheld die deutschen Kinoleinwände erklimmt. "Der grosse Japaner" läuft allerdings nur in ein paar ausgewählten, sympathischen Programmkinos. Das Publikum dort wird den Film wahrscheinlich auch um einiges mehr zu schätzen wissen, auch wenn "Dainipponjin" alles andere als anspruchsvoll ist. Aber Geschmackssache ist er mit Sicherheit. Nur Leute die eine gehörige Portion Trash vertragen, werden sich unterhalten wissen. Und so hinterlässt der Film die meisten Zuschauer vielleicht enttäuscht, aber eine kleine Minderheit klatscht halt doch beim Abspann.
Es wirkt ja fast ein bisschen kalkuliert, dass nach dem Erfolg von Will Smith´s "Hancock" nun noch ein ungeliebter Superheld die deutschen Kinoleinwände erklimmt. "Der grosse Japaner" läuft allerdings nur in ein paar ausgewählten, sympathischen Programmkinos. Das Publikum dort wird den Film wahrscheinlich auch um einiges mehr zu schätzen wissen, auch wenn "Dainipponjin" alles andere als anspruchsvoll ist. Aber Geschmackssache ist er mit Sicherheit. Nur Leute die eine gehörige Portion Trash vertragen, werden sich unterhalten wissen. Und so hinterlässt der Film die meisten Zuschauer vielleicht enttäuscht, aber eine kleine Minderheit klatscht halt doch beim Abspann."Der große Japaner" ist depressiv, melancholisch, geschieden, faul, aber eben der "große Japaner". Wenn man ihn unter Strom setzt, wird er zur ultimativen Waffe gegen alle auftauchenden Monstertiere, die was gegen Japan haben. Aber das ist lange überhaupt nicht wichtig, ein fiktiver Dokumentarfilmer folgt dem gehassten Superheld in seinem Alltag. Er füttert seine Katze, feilt sich die Fingernägel, geht Mittagessen, fährt Bahn, führt mit seiner Managerin Gespräche über seine Sponsoren oder geht mit seiner Tochter in den Zoo. Das alles wechselt sich ab mit langen Interviews. Anfangs noch gewöhnungsbedürftig mochte ich die verweigernde Haltung des Films immer mehr, Humor gibt es nur vereinzelt, trotz der grotesken Story gibt es nur wenige, ausgesuchte Schenkelklopfer und selbst die werden mit großer Ernsthaftigkeit dargestellt. So das sinnlose Ritual vor seiner Transformation und die riesige Unterhose, in die er erst hineinwachsen muss.
Obwohl schon bei Beginn des Films unbeliebt, geht die Karriere von Japans größtem Beschützer immer mehr bergab, Niederlagen häufen sich, als er dann auch noch ausversehen ein Kind-Monster tötet, verachtet ihn die Bevölkerung endgültig. Hitoshi Matumoto, Regiesseur und Hauptdarsteller, setzt die verweigernde Depression des Riesenjapaners wunderbar zurückhaltend um und der Film wäre wirklich ein schöner gewesen, wenn diese ständigen Stilbrüche ihm nicht so viel von seinem Charme nehmen würden. Der Camcorder-Realismus steht auf der einen Seite, billige Computeranimationen auf der anderen. Denn nachdem der Hauptdarsteller mutiert, nimmt der Film eine völlig andere Haltung ein. Der grosse Japaner muss nämlich einige Kämpfe ausfechten gegen bizarre Monster. Die Animationen sind schlecht, haben aber trotzdem nicht den Charme des Unperfekten. Diese Stilbrüche sind auf die Dauer nervig, statt auf Computertechnik hätte man auf mehr Herz hätte setzen sollen. Am Ende schließlich entwickelt sich der Film sogar zu einer "Realverfilmung", aber dass auf eine schrecklich klaumaukige Art und Weise, so dass der Stilbruch noch umso fataler wirkt. Trotzdem wird der Film allen gefallen, die auf WIRKLICH schräge Filme stehen, alle anderen sollten sich den Kinobesuch sparen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Samstag, 5. April 2008
Im Kino: Abgedreht (Be kind Rewind)
am Samstag, 5. April 2008, 00:45 im Topic 'Filmkritiken'
"I'll be Bill Murray and you'll be everyone else."
 Eines muss man ja dem neuen Film von Michel Gondry lassen: Er ist einfach ungeheuer sympathisch. Man merkt dem Cast den Spaß an, den sie bei den Dreharbeiten hatten und Jack Black bildet mit dem zurückhaltenden, fast scheuen Mos Def ein wunderbares Team. Der von Mos Def gespielte Mike arbeitet als Aushilfskraft in einer Videothek, die ihrer Bezeichnung noch gerecht wird, denn sie verkauft ausschließlich und entgegen aller Trends VHS-Kasseten. Genau die unhandlichen Boxen, die jetzt massenweise zusammen mit ihren Abspielgeräten in den Häuserkellern verschimmeln. Nur noch vereinzelt statten Kunden dem Laden noch einen Besuch ab, die meisten gehen zum DVDs-verkaufenden Monsterladen ein paar Straßen weiter. Nun soll aber der nostalgische Laden im morschen Reihenhaus schicken, neuen Wohnungen weichen. Um das zu verhindern, spioniert der Besitzer Mr. Fletcher die Konkurrenz aus, um deren Verkaufstechniken zu übernehmen. Währenddessen übernimmt Mike den Laden, doch Jerry alias Jack Black will lieber das örtliche Kraftwerk sabotieren. Und so kommt es, wie es kommen muss: Jerry wird während seiner nächtlichen Aktion magnetisiert (was zu einigen komischen Situationen führt) und löscht während eines Ladenbesuchs alle vorhandenen Bänder. Doch die Kunden warten und darum drehen Mike und Jerry die Filme einfach selber. Das Ergebnis sind die ungeheuer witzigen Amateurremakes von den typischen Blockbustern der Achtziger und Neunziger. Den Anfang bildet eine eigenwillige Version von Ghostbustern, dessen Herstellung zu den witzigsten Szenen des Films gehört, denn es werden vermeintliche Monsterkatzen mit Sprühschaum gejagt und in der Bibliothek fremden Menschen mit Lamettaschlangen aufgelauert. Natürlich spricht sich das Amateur-Remake bald herum und die Videothek kann sich nicht mehr retten vor Leuten, die ihre Filme "schweden" (so bezeichnen die Filmemacher ihre Werke) lassen wollen. Diese ungeschliffenen Filmchen bilden das Epizentrum des Films, die Geschichte drumherum ist nur sekundär, und das merkt man dem Film leider auch an. So witzig die "geschwedeten" Filmklassiker sein mögen, so richtig weiß der Film nicht, was er erzählen will, tut es aber trotzdem, weshalb ihm nach dem Ghostbustersremake öfters die Luft ausgeht und der Zuschauer kein echtes Interesse entwickelt. Und das trotz der wirklich wunderbaren Darstellerleistungen, auch oder besonders der Nebenfiguren, allen voran der von Danny Glover gespielte Mr. Fletcher, der den Youngstern Jack Black und Mos Def eindeutig die Show stielt. Die obligatorische Krise, die alle Träume der ambitionierten Hobbyfilmer zerschlägt ist dann die zurecht angeprangerte Hollywood-Industrie, welche (was in unseren Zeiten hochaktuell ist) die Urheberrechte verletzt sieht und alle Werke zerstören lässt. Doch das Problem ist schnell gelöst, in dem man seinen eigenen Film dreht. Ein wunderbares, fiktionales Biopic eines Jazzmusikers, der angeblich in dem Viertel des Videoladens lebte. Angenehm ist auch, dass der Film hier nie in schöngeistigen Kitsch verfällt, auch wenn das Ende hart an der Grenze zwischen Feel-Good-Movie und penetrantem Optimismus liegt. Trotzdem ist "Abgedreht" in seiner Botschaft einem doch so bodenlos sympathisch, dass man ihn dann doch nicht ganz so schnell vergisst.
Eines muss man ja dem neuen Film von Michel Gondry lassen: Er ist einfach ungeheuer sympathisch. Man merkt dem Cast den Spaß an, den sie bei den Dreharbeiten hatten und Jack Black bildet mit dem zurückhaltenden, fast scheuen Mos Def ein wunderbares Team. Der von Mos Def gespielte Mike arbeitet als Aushilfskraft in einer Videothek, die ihrer Bezeichnung noch gerecht wird, denn sie verkauft ausschließlich und entgegen aller Trends VHS-Kasseten. Genau die unhandlichen Boxen, die jetzt massenweise zusammen mit ihren Abspielgeräten in den Häuserkellern verschimmeln. Nur noch vereinzelt statten Kunden dem Laden noch einen Besuch ab, die meisten gehen zum DVDs-verkaufenden Monsterladen ein paar Straßen weiter. Nun soll aber der nostalgische Laden im morschen Reihenhaus schicken, neuen Wohnungen weichen. Um das zu verhindern, spioniert der Besitzer Mr. Fletcher die Konkurrenz aus, um deren Verkaufstechniken zu übernehmen. Währenddessen übernimmt Mike den Laden, doch Jerry alias Jack Black will lieber das örtliche Kraftwerk sabotieren. Und so kommt es, wie es kommen muss: Jerry wird während seiner nächtlichen Aktion magnetisiert (was zu einigen komischen Situationen führt) und löscht während eines Ladenbesuchs alle vorhandenen Bänder. Doch die Kunden warten und darum drehen Mike und Jerry die Filme einfach selber. Das Ergebnis sind die ungeheuer witzigen Amateurremakes von den typischen Blockbustern der Achtziger und Neunziger. Den Anfang bildet eine eigenwillige Version von Ghostbustern, dessen Herstellung zu den witzigsten Szenen des Films gehört, denn es werden vermeintliche Monsterkatzen mit Sprühschaum gejagt und in der Bibliothek fremden Menschen mit Lamettaschlangen aufgelauert. Natürlich spricht sich das Amateur-Remake bald herum und die Videothek kann sich nicht mehr retten vor Leuten, die ihre Filme "schweden" (so bezeichnen die Filmemacher ihre Werke) lassen wollen. Diese ungeschliffenen Filmchen bilden das Epizentrum des Films, die Geschichte drumherum ist nur sekundär, und das merkt man dem Film leider auch an. So witzig die "geschwedeten" Filmklassiker sein mögen, so richtig weiß der Film nicht, was er erzählen will, tut es aber trotzdem, weshalb ihm nach dem Ghostbustersremake öfters die Luft ausgeht und der Zuschauer kein echtes Interesse entwickelt. Und das trotz der wirklich wunderbaren Darstellerleistungen, auch oder besonders der Nebenfiguren, allen voran der von Danny Glover gespielte Mr. Fletcher, der den Youngstern Jack Black und Mos Def eindeutig die Show stielt. Die obligatorische Krise, die alle Träume der ambitionierten Hobbyfilmer zerschlägt ist dann die zurecht angeprangerte Hollywood-Industrie, welche (was in unseren Zeiten hochaktuell ist) die Urheberrechte verletzt sieht und alle Werke zerstören lässt. Doch das Problem ist schnell gelöst, in dem man seinen eigenen Film dreht. Ein wunderbares, fiktionales Biopic eines Jazzmusikers, der angeblich in dem Viertel des Videoladens lebte. Angenehm ist auch, dass der Film hier nie in schöngeistigen Kitsch verfällt, auch wenn das Ende hart an der Grenze zwischen Feel-Good-Movie und penetrantem Optimismus liegt. Trotzdem ist "Abgedreht" in seiner Botschaft einem doch so bodenlos sympathisch, dass man ihn dann doch nicht ganz so schnell vergisst.
65%
 Eines muss man ja dem neuen Film von Michel Gondry lassen: Er ist einfach ungeheuer sympathisch. Man merkt dem Cast den Spaß an, den sie bei den Dreharbeiten hatten und Jack Black bildet mit dem zurückhaltenden, fast scheuen Mos Def ein wunderbares Team. Der von Mos Def gespielte Mike arbeitet als Aushilfskraft in einer Videothek, die ihrer Bezeichnung noch gerecht wird, denn sie verkauft ausschließlich und entgegen aller Trends VHS-Kasseten. Genau die unhandlichen Boxen, die jetzt massenweise zusammen mit ihren Abspielgeräten in den Häuserkellern verschimmeln. Nur noch vereinzelt statten Kunden dem Laden noch einen Besuch ab, die meisten gehen zum DVDs-verkaufenden Monsterladen ein paar Straßen weiter. Nun soll aber der nostalgische Laden im morschen Reihenhaus schicken, neuen Wohnungen weichen. Um das zu verhindern, spioniert der Besitzer Mr. Fletcher die Konkurrenz aus, um deren Verkaufstechniken zu übernehmen. Währenddessen übernimmt Mike den Laden, doch Jerry alias Jack Black will lieber das örtliche Kraftwerk sabotieren. Und so kommt es, wie es kommen muss: Jerry wird während seiner nächtlichen Aktion magnetisiert (was zu einigen komischen Situationen führt) und löscht während eines Ladenbesuchs alle vorhandenen Bänder. Doch die Kunden warten und darum drehen Mike und Jerry die Filme einfach selber. Das Ergebnis sind die ungeheuer witzigen Amateurremakes von den typischen Blockbustern der Achtziger und Neunziger. Den Anfang bildet eine eigenwillige Version von Ghostbustern, dessen Herstellung zu den witzigsten Szenen des Films gehört, denn es werden vermeintliche Monsterkatzen mit Sprühschaum gejagt und in der Bibliothek fremden Menschen mit Lamettaschlangen aufgelauert. Natürlich spricht sich das Amateur-Remake bald herum und die Videothek kann sich nicht mehr retten vor Leuten, die ihre Filme "schweden" (so bezeichnen die Filmemacher ihre Werke) lassen wollen. Diese ungeschliffenen Filmchen bilden das Epizentrum des Films, die Geschichte drumherum ist nur sekundär, und das merkt man dem Film leider auch an. So witzig die "geschwedeten" Filmklassiker sein mögen, so richtig weiß der Film nicht, was er erzählen will, tut es aber trotzdem, weshalb ihm nach dem Ghostbustersremake öfters die Luft ausgeht und der Zuschauer kein echtes Interesse entwickelt. Und das trotz der wirklich wunderbaren Darstellerleistungen, auch oder besonders der Nebenfiguren, allen voran der von Danny Glover gespielte Mr. Fletcher, der den Youngstern Jack Black und Mos Def eindeutig die Show stielt. Die obligatorische Krise, die alle Träume der ambitionierten Hobbyfilmer zerschlägt ist dann die zurecht angeprangerte Hollywood-Industrie, welche (was in unseren Zeiten hochaktuell ist) die Urheberrechte verletzt sieht und alle Werke zerstören lässt. Doch das Problem ist schnell gelöst, in dem man seinen eigenen Film dreht. Ein wunderbares, fiktionales Biopic eines Jazzmusikers, der angeblich in dem Viertel des Videoladens lebte. Angenehm ist auch, dass der Film hier nie in schöngeistigen Kitsch verfällt, auch wenn das Ende hart an der Grenze zwischen Feel-Good-Movie und penetrantem Optimismus liegt. Trotzdem ist "Abgedreht" in seiner Botschaft einem doch so bodenlos sympathisch, dass man ihn dann doch nicht ganz so schnell vergisst.
Eines muss man ja dem neuen Film von Michel Gondry lassen: Er ist einfach ungeheuer sympathisch. Man merkt dem Cast den Spaß an, den sie bei den Dreharbeiten hatten und Jack Black bildet mit dem zurückhaltenden, fast scheuen Mos Def ein wunderbares Team. Der von Mos Def gespielte Mike arbeitet als Aushilfskraft in einer Videothek, die ihrer Bezeichnung noch gerecht wird, denn sie verkauft ausschließlich und entgegen aller Trends VHS-Kasseten. Genau die unhandlichen Boxen, die jetzt massenweise zusammen mit ihren Abspielgeräten in den Häuserkellern verschimmeln. Nur noch vereinzelt statten Kunden dem Laden noch einen Besuch ab, die meisten gehen zum DVDs-verkaufenden Monsterladen ein paar Straßen weiter. Nun soll aber der nostalgische Laden im morschen Reihenhaus schicken, neuen Wohnungen weichen. Um das zu verhindern, spioniert der Besitzer Mr. Fletcher die Konkurrenz aus, um deren Verkaufstechniken zu übernehmen. Währenddessen übernimmt Mike den Laden, doch Jerry alias Jack Black will lieber das örtliche Kraftwerk sabotieren. Und so kommt es, wie es kommen muss: Jerry wird während seiner nächtlichen Aktion magnetisiert (was zu einigen komischen Situationen führt) und löscht während eines Ladenbesuchs alle vorhandenen Bänder. Doch die Kunden warten und darum drehen Mike und Jerry die Filme einfach selber. Das Ergebnis sind die ungeheuer witzigen Amateurremakes von den typischen Blockbustern der Achtziger und Neunziger. Den Anfang bildet eine eigenwillige Version von Ghostbustern, dessen Herstellung zu den witzigsten Szenen des Films gehört, denn es werden vermeintliche Monsterkatzen mit Sprühschaum gejagt und in der Bibliothek fremden Menschen mit Lamettaschlangen aufgelauert. Natürlich spricht sich das Amateur-Remake bald herum und die Videothek kann sich nicht mehr retten vor Leuten, die ihre Filme "schweden" (so bezeichnen die Filmemacher ihre Werke) lassen wollen. Diese ungeschliffenen Filmchen bilden das Epizentrum des Films, die Geschichte drumherum ist nur sekundär, und das merkt man dem Film leider auch an. So witzig die "geschwedeten" Filmklassiker sein mögen, so richtig weiß der Film nicht, was er erzählen will, tut es aber trotzdem, weshalb ihm nach dem Ghostbustersremake öfters die Luft ausgeht und der Zuschauer kein echtes Interesse entwickelt. Und das trotz der wirklich wunderbaren Darstellerleistungen, auch oder besonders der Nebenfiguren, allen voran der von Danny Glover gespielte Mr. Fletcher, der den Youngstern Jack Black und Mos Def eindeutig die Show stielt. Die obligatorische Krise, die alle Träume der ambitionierten Hobbyfilmer zerschlägt ist dann die zurecht angeprangerte Hollywood-Industrie, welche (was in unseren Zeiten hochaktuell ist) die Urheberrechte verletzt sieht und alle Werke zerstören lässt. Doch das Problem ist schnell gelöst, in dem man seinen eigenen Film dreht. Ein wunderbares, fiktionales Biopic eines Jazzmusikers, der angeblich in dem Viertel des Videoladens lebte. Angenehm ist auch, dass der Film hier nie in schöngeistigen Kitsch verfällt, auch wenn das Ende hart an der Grenze zwischen Feel-Good-Movie und penetrantem Optimismus liegt. Trotzdem ist "Abgedreht" in seiner Botschaft einem doch so bodenlos sympathisch, dass man ihn dann doch nicht ganz so schnell vergisst.65%
Permalink (2 Kommentare) Kommentieren
Sonntag, 2. März 2008
Im Kino: No Country for Old Men
am Sonntag, 2. März 2008, 21:08 im Topic 'Filmkritiken'
"What's the most you ever lost on a coin toss?
 Als Erstes muss ich sagen, "No Country for Old Men" hat den Oscar nicht verdient. Oder besser, der Oscar hat "No Country for Old Men" nicht verdient. Filme wie "Titanic" gewinnen Oscars, aber nicht ein Neo-Noir-Film von den Coen Bruedern. Schon wegen der Gewalt dürfte der Film vielen Leuten nicht gefallen und die pessimistische Weltsicht wird auch so einige Leute nicht zufrieden stellen. Es ist mir also ein Rätsel wie ein so großartiges Meisterwerk wie dieses den Oscar für den besten Film einheimsen konnte.
Als Erstes muss ich sagen, "No Country for Old Men" hat den Oscar nicht verdient. Oder besser, der Oscar hat "No Country for Old Men" nicht verdient. Filme wie "Titanic" gewinnen Oscars, aber nicht ein Neo-Noir-Film von den Coen Bruedern. Schon wegen der Gewalt dürfte der Film vielen Leuten nicht gefallen und die pessimistische Weltsicht wird auch so einige Leute nicht zufrieden stellen. Es ist mir also ein Rätsel wie ein so großartiges Meisterwerk wie dieses den Oscar für den besten Film einheimsen konnte.
Denn "No Country for Old Men" ist der großartigste Film seit langer Zeit und ich bin mir sicher, an ihn wird man sich noch viele Jahrzente lang erinnern.
"No Country for Old Men" wird als ein Klassiker in die Filmgeschichte eingehen, unter anderem, weil er nicht wie viele andere Oscar-Kandidaten dieses Jahr, die ganze Welt erklären will, es aber schlussendlich und ein bisschen unfreiwillig doch tut. Der Film ist kein Kunstfilm, der sich selber auf einen so hohen Thron hievt, dass er dabei den Zuschauer vergisst, nein, "No Country for Old Men" ist vor allem ein ungeheuer spannender Film. Von der ersten Minute an durchzieht den Film eine selten dichte Atmosphäre und knisternde Spannung.
Bevor der Film richtig beginnt, wird der Zuschauer gütigerweise auf das Kommende vorbereitet, eine ältliche Stimme im Off redet, während wunderschöner Bilder aus dem amerikanischen Nirgendwo. Es ist die Stimme von Sheriff Ed Tom Bell alias Tommy Lee Jones, er erzählt von seinen Vorfahren die gleichwohl ihres Berufes nie eine Waffe trugen und wie er vor Kurzem einen Jungen auf den elektrischen Stuhl brachte, da dieser ein 14-Jähriges Mädchen ermordet hatte. "He killt a fourteen-year-old girl. Papers said it was a crime of passion but he told me there wasn't any passion to it. Told me that he'd been planning to kill somebody for about as long as he could remember. Said that if they turned him out he'd do it again. Said he knew he was going to hell. Be there in about fifteen minutes." Das Morden wird nie aufhören, wie dieser Film einem in den nächsten 2 Stunden klar macht.
Dann tritt Anton Chigurh auf, diese Figur, die einen noch lange verfolgen wird, weil Javier Bardem ihr so eindrucksvoll Leben eingehaucht hat. Wir sehen, wie er abgeführt wird, er von einem blonden Officer in die Polizeistation genommen wird. Doch es ist nicht der Glückstag des Beamten, denn Anton Chigurh ist der kaltblütigste Mörder jenseits des Misissipi und so findet sich der Blonde bald im Todeskampf zappelnd auf dem Boden. Ich bin recht resistent, was Gewalt in Filmen angeht, aber bei dieser frühen Strangulationsszene haben sich auch mir die Nackenhaare aufgestellt. Weniger wegen des spritzenden Blutes, als wegen des Gesichtsausdrucks Bardems, während er sein Opfer tötet.
Den Gegenpart zu Chigurh bildet B-Movie Schauspieler Josh Brolin als Llewelyn Moss, der ebenfalls großartig spielt. Während einer seiner Jagdtouren entdeckt er ein Mexikanergrab, ein geplatzter Drogendeal, bei dem sich die Parteien sich schließlich gegenseitig umbrachten. Was jedoch nicht verschwunden, sind massenweise Kokain und ein Koffer mit zwei Millionen Dollar in Bar. Als Arbeitsloser denkt er nicht lange nach und nimmt das Geld mit nach Hause, gleichwohl er ahnt, mit welchen Leuten er sich mit dieser Aktion anlegt.
Llewelyn Moss: If I don't come back, tell mother I love her.
Carla Jean Moss: Your mother's dead, Llewelyn.
Llewelyn Moss: Well then I'll tell her myself.
Der Dritte im Bunde ist dann noch Sheriff Ed Tom Bell, der stets einen Tick zu spät kommt, um Chigurh zu fassen, der eine unfassliche Blutspur hinter sich her zieht. Aus dieser Konstellation entwickelt sich der Film dann zu einem unglaublich spannenden Duell zwischen Moss und Chigurh. Ein klassisches Neo-Noir Thema, eine Jagd wie einem Roman meines Lieblingsautors Jean-Patrick Manchette entlehnt. Der Film zieht seine ungeheure Intensitaet auch daraus, dass
ein Score praktisch nicht vorhanden ist und somit jede Art von Pathos vermieden wird, die grandiose, beobachtende Kamera von Roger Deakins unterstreicht das. Einige Sequenzen sind fast hitchcockhaft spannend, es zerreisst einen förmlich im Sessel.
Der Film ist eine Jagd durch ein gewalttätiges und mitleidloses Amerika und die Dörfer und Motels werden in ihrer ganzen Hässlichkeit gezeigt. Einen gewissen Roadmovie-Charakter kann man dem Film nicht absprechen und wie in jedem Coen-Film sind die Nebenrollen oft sehr überzeichnet und kauzig. Dadurch lassen die Coens stets diese berühmten Dialoge entstehen, die selbst einem Tarantino das Wasser reichen. Doch was in meinen Augen die Coens zu besseren Regiesseuren macht als Tarantinon ist, dass ihre Filme nie oberflächlich sind. Hinter den komischen Szenen steckt immer ein ernster Hintergrund und so ist es zwar ungeheur witzig, wenn Llewelyn Moss halbnackt in einen Klamottenladen stürzt, doch trotzdem spürt man immer noch die Verzweiflung eines Mannes auf der Flucht.
Die wenigen Konfrontationen zwischen Moss und Chigurh fallen zwar ausserordentlich blutig aus, doch "No Country for Old Men" ist kein Actionfilm, sondern ein Film über das Morden. Dafür spricht auch, dass Chigurh so viel Angst verbreitet weil er zwar ein Rätsel ist, aber als Figur ungeheuer echt wirkt. Doch der größte Grund, weshalb einen "No Cuntry for Old Men" nicht so schnell wieder los lässt, ist, dass er auf morbide Weise einem die Allgegenwärtigkeit des Todes oder noch mehr der Gewalt klar macht. Die Coens nehmen einem damit ein bisschen die Sichertsblase in die man sich automatisch im Leben einlullt. Nicht jeder wird das Mögen, doch jeder wird darüber, ob bewusst oder unbewusst, nachdenken müssen.
 Als Erstes muss ich sagen, "No Country for Old Men" hat den Oscar nicht verdient. Oder besser, der Oscar hat "No Country for Old Men" nicht verdient. Filme wie "Titanic" gewinnen Oscars, aber nicht ein Neo-Noir-Film von den Coen Bruedern. Schon wegen der Gewalt dürfte der Film vielen Leuten nicht gefallen und die pessimistische Weltsicht wird auch so einige Leute nicht zufrieden stellen. Es ist mir also ein Rätsel wie ein so großartiges Meisterwerk wie dieses den Oscar für den besten Film einheimsen konnte.
Als Erstes muss ich sagen, "No Country for Old Men" hat den Oscar nicht verdient. Oder besser, der Oscar hat "No Country for Old Men" nicht verdient. Filme wie "Titanic" gewinnen Oscars, aber nicht ein Neo-Noir-Film von den Coen Bruedern. Schon wegen der Gewalt dürfte der Film vielen Leuten nicht gefallen und die pessimistische Weltsicht wird auch so einige Leute nicht zufrieden stellen. Es ist mir also ein Rätsel wie ein so großartiges Meisterwerk wie dieses den Oscar für den besten Film einheimsen konnte.Denn "No Country for Old Men" ist der großartigste Film seit langer Zeit und ich bin mir sicher, an ihn wird man sich noch viele Jahrzente lang erinnern.
"No Country for Old Men" wird als ein Klassiker in die Filmgeschichte eingehen, unter anderem, weil er nicht wie viele andere Oscar-Kandidaten dieses Jahr, die ganze Welt erklären will, es aber schlussendlich und ein bisschen unfreiwillig doch tut. Der Film ist kein Kunstfilm, der sich selber auf einen so hohen Thron hievt, dass er dabei den Zuschauer vergisst, nein, "No Country for Old Men" ist vor allem ein ungeheuer spannender Film. Von der ersten Minute an durchzieht den Film eine selten dichte Atmosphäre und knisternde Spannung.
Bevor der Film richtig beginnt, wird der Zuschauer gütigerweise auf das Kommende vorbereitet, eine ältliche Stimme im Off redet, während wunderschöner Bilder aus dem amerikanischen Nirgendwo. Es ist die Stimme von Sheriff Ed Tom Bell alias Tommy Lee Jones, er erzählt von seinen Vorfahren die gleichwohl ihres Berufes nie eine Waffe trugen und wie er vor Kurzem einen Jungen auf den elektrischen Stuhl brachte, da dieser ein 14-Jähriges Mädchen ermordet hatte. "He killt a fourteen-year-old girl. Papers said it was a crime of passion but he told me there wasn't any passion to it. Told me that he'd been planning to kill somebody for about as long as he could remember. Said that if they turned him out he'd do it again. Said he knew he was going to hell. Be there in about fifteen minutes." Das Morden wird nie aufhören, wie dieser Film einem in den nächsten 2 Stunden klar macht.
Dann tritt Anton Chigurh auf, diese Figur, die einen noch lange verfolgen wird, weil Javier Bardem ihr so eindrucksvoll Leben eingehaucht hat. Wir sehen, wie er abgeführt wird, er von einem blonden Officer in die Polizeistation genommen wird. Doch es ist nicht der Glückstag des Beamten, denn Anton Chigurh ist der kaltblütigste Mörder jenseits des Misissipi und so findet sich der Blonde bald im Todeskampf zappelnd auf dem Boden. Ich bin recht resistent, was Gewalt in Filmen angeht, aber bei dieser frühen Strangulationsszene haben sich auch mir die Nackenhaare aufgestellt. Weniger wegen des spritzenden Blutes, als wegen des Gesichtsausdrucks Bardems, während er sein Opfer tötet.
Den Gegenpart zu Chigurh bildet B-Movie Schauspieler Josh Brolin als Llewelyn Moss, der ebenfalls großartig spielt. Während einer seiner Jagdtouren entdeckt er ein Mexikanergrab, ein geplatzter Drogendeal, bei dem sich die Parteien sich schließlich gegenseitig umbrachten. Was jedoch nicht verschwunden, sind massenweise Kokain und ein Koffer mit zwei Millionen Dollar in Bar. Als Arbeitsloser denkt er nicht lange nach und nimmt das Geld mit nach Hause, gleichwohl er ahnt, mit welchen Leuten er sich mit dieser Aktion anlegt.
Llewelyn Moss: If I don't come back, tell mother I love her.
Carla Jean Moss: Your mother's dead, Llewelyn.
Llewelyn Moss: Well then I'll tell her myself.
Der Dritte im Bunde ist dann noch Sheriff Ed Tom Bell, der stets einen Tick zu spät kommt, um Chigurh zu fassen, der eine unfassliche Blutspur hinter sich her zieht. Aus dieser Konstellation entwickelt sich der Film dann zu einem unglaublich spannenden Duell zwischen Moss und Chigurh. Ein klassisches Neo-Noir Thema, eine Jagd wie einem Roman meines Lieblingsautors Jean-Patrick Manchette entlehnt. Der Film zieht seine ungeheure Intensitaet auch daraus, dass
ein Score praktisch nicht vorhanden ist und somit jede Art von Pathos vermieden wird, die grandiose, beobachtende Kamera von Roger Deakins unterstreicht das. Einige Sequenzen sind fast hitchcockhaft spannend, es zerreisst einen förmlich im Sessel.
Der Film ist eine Jagd durch ein gewalttätiges und mitleidloses Amerika und die Dörfer und Motels werden in ihrer ganzen Hässlichkeit gezeigt. Einen gewissen Roadmovie-Charakter kann man dem Film nicht absprechen und wie in jedem Coen-Film sind die Nebenrollen oft sehr überzeichnet und kauzig. Dadurch lassen die Coens stets diese berühmten Dialoge entstehen, die selbst einem Tarantino das Wasser reichen. Doch was in meinen Augen die Coens zu besseren Regiesseuren macht als Tarantinon ist, dass ihre Filme nie oberflächlich sind. Hinter den komischen Szenen steckt immer ein ernster Hintergrund und so ist es zwar ungeheur witzig, wenn Llewelyn Moss halbnackt in einen Klamottenladen stürzt, doch trotzdem spürt man immer noch die Verzweiflung eines Mannes auf der Flucht.
Die wenigen Konfrontationen zwischen Moss und Chigurh fallen zwar ausserordentlich blutig aus, doch "No Country for Old Men" ist kein Actionfilm, sondern ein Film über das Morden. Dafür spricht auch, dass Chigurh so viel Angst verbreitet weil er zwar ein Rätsel ist, aber als Figur ungeheuer echt wirkt. Doch der größte Grund, weshalb einen "No Cuntry for Old Men" nicht so schnell wieder los lässt, ist, dass er auf morbide Weise einem die Allgegenwärtigkeit des Todes oder noch mehr der Gewalt klar macht. Die Coens nehmen einem damit ein bisschen die Sichertsblase in die man sich automatisch im Leben einlullt. Nicht jeder wird das Mögen, doch jeder wird darüber, ob bewusst oder unbewusst, nachdenken müssen.
Permalink (3 Kommentare) Kommentieren
Sonntag, 24. Februar 2008
Im Kino: There will be Blood
am Sonntag, 24. Februar 2008, 18:40 im Topic 'Filmkritiken'
"I want to earn enough money that I can get away from everyone."
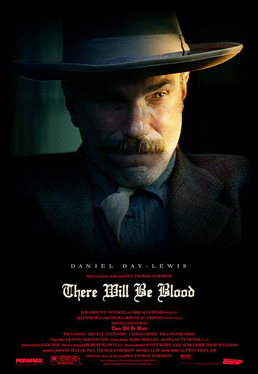 Es gibt diese Filme, die von den Feuilletons in den Himmel gelobt werden, die als Klassiker gehandelt werden, die von jedem geschätzten Kritiker auf dieser Erde, so scheint es, als revolutionäres Meisterwerk betitelt werden, aber man selber sitzt nach dem Film im Sessel und denkt darüber nach, ob man gerade eben dieses Meisterwerk, von dem die ganze Welt erzählt, gesehen hat.
Es gibt diese Filme, die von den Feuilletons in den Himmel gelobt werden, die als Klassiker gehandelt werden, die von jedem geschätzten Kritiker auf dieser Erde, so scheint es, als revolutionäres Meisterwerk betitelt werden, aber man selber sitzt nach dem Film im Sessel und denkt darüber nach, ob man gerade eben dieses Meisterwerk, von dem die ganze Welt erzählt, gesehen hat.
Genau so geschah es nach dem Sehen von "There will be Blood", dem Berlinale-Favoriten von dem Regiesseur, der unter manchen Filmophilen fast religiös verehrt wird. Und "There will be Blood" ist lang. Nicht nur von der Laufzeit her, sondern auch von der Geschichte. Episch. Und bei Filmen die generell als Epos abgestempelt werden, bin ich meistens schon skeptisch, doch bei "There will be Blood" haben die Lobeshymnen mich so eingelullt, dass die meiste Skepsis verflog. Doch "There will be Blood" ist ein Epos, im Guten wie im Schlechten. Und außerdem natürlich ein Kunstfilm, und auch das im Guten wie im Schlechten, denn wie so viele Festivalfilme ruht sich der Film auf den eigenen Lorbeeren aus, die man ihm schon vorher auf die Stirn legt. Sequenzen, die in jedem "publikumsorientierten" Film sofort rausfliegen würden, dürfen in dem sich selbst als Kunst titulierende Epos aber auf keinen Fall rausgeschnitten werden, denn hier hat ja alles einen besonderen Sinn. Dabei habe ich nun wirklich nichts gegen langsame Filme, ganz im Gegenteil, viele meiner Lieblingsfilme haben fast überhaupt keine Handlung, und zu viel Handlung langweilt mich auch, doch wenn ein Film wie "There will be Blood" sich so sperrig gibt wie er es tut, dann sollte man das kritisieren und nicht auf der pseudointelektuellen Welle mitreiten. "Die Ermordung Jesse James", mindestens genau so wenig Handlung enthaltend wie "There will be Blood" und ebenfalls dieses Jahr in die Kinos gekommen, hat das für mich besser hingekriegt, da eine Atmosphäre geschaffen wurde und die ist fast immer wichtiger als die Handlung.
Meine erste Reaktion nach dem Film war ,glimpflich ausgedrückt, eine enttäuschte, doch je länger der Film nachwirkt, desto besser wird er in meinen Augen.
"There will be Blood" spielt in der Zeit, in der gewissermassen der Ursprung des heutigen Kapitalismus liegt. Die Paraderolle des gierigen Kapitalisten übernimmt hier Daniel Day-Lewis als Daniel Plainview, jemand der sich selber als "Ölmann" bezeichnet und alles dafür tut um seine Gier nach mehr Besitz zu stillen. Jemand der sich gerne emotionslos wissen würde, aber doch seinen Begleiter, ein Kind, liebt auch wenn er später behauptet er hätte es nur mitgenommen, um mehr Öl verkaufen zu können. Recht anschaulich beschreibt Anderson, wie die Gier und der Neid das ist, auf dem die Zivilisation aufbaut. Plainview ist ein Gefangener seines eigenen Erfolgstriebes und geht für ihn bis zur psychischen Selbstverstümmelung. Ein echter Unsympath und doch die einzige Figur an die sich der Zuschauer krallen kann unter all den Unsympathen. Denn auf der anderen Seite der knallharten Kapitalisten steht die Kirche, die noch viel zerstörerischer, verlogener und heuchlerischer ist als die kapitalistischen Geschäftsmänner, die wenigstens dazu stehen, was sie sind. Eins muss man dem Film lassen, mit dem von Paul Dano genial verkörperten Priester Eli Sunday wurde eine der hassenswerten Filmfiguren überhaupt geschaffen. Und so steckt dahinter wie Anderson am Beispiel dieser Todfeinde zeigt wie die Gier und der Hass die Ideale auffressen eine große Wahrheit.
Die Kamera bleibt bei Szenen in denen derartiges Gestalt annimmt nah bei den Schauspielern, gerade zu kammerspielartig, und wechselt doch ungeheuer schnell wieder in eine weite, pompöse und doch minimalistische Bildsprache. Die Dörfer sind fast grotesk karg und trostlos und die Weiten des Westens ebenfalls. Fast romantisch mutet da die opernhaft inszenierte Bohrturmexplosion an.
Eine große Rolle dabei spielt auch die Musik, bei der das Adjektiv "experimentell" noch stark untertreiben würde. Ständig Geigen, die schrecklich schief vor sich hin sägen und bei schnelleren Szenen immer wieder ein schwer zu beschreibendes Klickerklacker. Ich bin ja offen für alles, aber schief ist schief.
Und so bleibt "There will be Blood" zwar ein Film mit hochinteressanten Ansätzen, der aber an seinem eigenen, schrecklich nervenden, Kunstwillen scheitert.
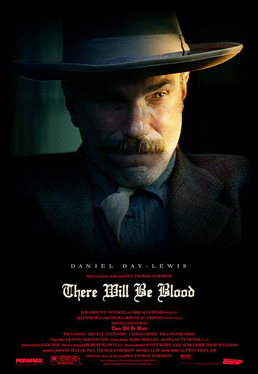 Es gibt diese Filme, die von den Feuilletons in den Himmel gelobt werden, die als Klassiker gehandelt werden, die von jedem geschätzten Kritiker auf dieser Erde, so scheint es, als revolutionäres Meisterwerk betitelt werden, aber man selber sitzt nach dem Film im Sessel und denkt darüber nach, ob man gerade eben dieses Meisterwerk, von dem die ganze Welt erzählt, gesehen hat.
Es gibt diese Filme, die von den Feuilletons in den Himmel gelobt werden, die als Klassiker gehandelt werden, die von jedem geschätzten Kritiker auf dieser Erde, so scheint es, als revolutionäres Meisterwerk betitelt werden, aber man selber sitzt nach dem Film im Sessel und denkt darüber nach, ob man gerade eben dieses Meisterwerk, von dem die ganze Welt erzählt, gesehen hat. Genau so geschah es nach dem Sehen von "There will be Blood", dem Berlinale-Favoriten von dem Regiesseur, der unter manchen Filmophilen fast religiös verehrt wird. Und "There will be Blood" ist lang. Nicht nur von der Laufzeit her, sondern auch von der Geschichte. Episch. Und bei Filmen die generell als Epos abgestempelt werden, bin ich meistens schon skeptisch, doch bei "There will be Blood" haben die Lobeshymnen mich so eingelullt, dass die meiste Skepsis verflog. Doch "There will be Blood" ist ein Epos, im Guten wie im Schlechten. Und außerdem natürlich ein Kunstfilm, und auch das im Guten wie im Schlechten, denn wie so viele Festivalfilme ruht sich der Film auf den eigenen Lorbeeren aus, die man ihm schon vorher auf die Stirn legt. Sequenzen, die in jedem "publikumsorientierten" Film sofort rausfliegen würden, dürfen in dem sich selbst als Kunst titulierende Epos aber auf keinen Fall rausgeschnitten werden, denn hier hat ja alles einen besonderen Sinn. Dabei habe ich nun wirklich nichts gegen langsame Filme, ganz im Gegenteil, viele meiner Lieblingsfilme haben fast überhaupt keine Handlung, und zu viel Handlung langweilt mich auch, doch wenn ein Film wie "There will be Blood" sich so sperrig gibt wie er es tut, dann sollte man das kritisieren und nicht auf der pseudointelektuellen Welle mitreiten. "Die Ermordung Jesse James", mindestens genau so wenig Handlung enthaltend wie "There will be Blood" und ebenfalls dieses Jahr in die Kinos gekommen, hat das für mich besser hingekriegt, da eine Atmosphäre geschaffen wurde und die ist fast immer wichtiger als die Handlung.
Meine erste Reaktion nach dem Film war ,glimpflich ausgedrückt, eine enttäuschte, doch je länger der Film nachwirkt, desto besser wird er in meinen Augen.
"There will be Blood" spielt in der Zeit, in der gewissermassen der Ursprung des heutigen Kapitalismus liegt. Die Paraderolle des gierigen Kapitalisten übernimmt hier Daniel Day-Lewis als Daniel Plainview, jemand der sich selber als "Ölmann" bezeichnet und alles dafür tut um seine Gier nach mehr Besitz zu stillen. Jemand der sich gerne emotionslos wissen würde, aber doch seinen Begleiter, ein Kind, liebt auch wenn er später behauptet er hätte es nur mitgenommen, um mehr Öl verkaufen zu können. Recht anschaulich beschreibt Anderson, wie die Gier und der Neid das ist, auf dem die Zivilisation aufbaut. Plainview ist ein Gefangener seines eigenen Erfolgstriebes und geht für ihn bis zur psychischen Selbstverstümmelung. Ein echter Unsympath und doch die einzige Figur an die sich der Zuschauer krallen kann unter all den Unsympathen. Denn auf der anderen Seite der knallharten Kapitalisten steht die Kirche, die noch viel zerstörerischer, verlogener und heuchlerischer ist als die kapitalistischen Geschäftsmänner, die wenigstens dazu stehen, was sie sind. Eins muss man dem Film lassen, mit dem von Paul Dano genial verkörperten Priester Eli Sunday wurde eine der hassenswerten Filmfiguren überhaupt geschaffen. Und so steckt dahinter wie Anderson am Beispiel dieser Todfeinde zeigt wie die Gier und der Hass die Ideale auffressen eine große Wahrheit.
Die Kamera bleibt bei Szenen in denen derartiges Gestalt annimmt nah bei den Schauspielern, gerade zu kammerspielartig, und wechselt doch ungeheuer schnell wieder in eine weite, pompöse und doch minimalistische Bildsprache. Die Dörfer sind fast grotesk karg und trostlos und die Weiten des Westens ebenfalls. Fast romantisch mutet da die opernhaft inszenierte Bohrturmexplosion an.
Eine große Rolle dabei spielt auch die Musik, bei der das Adjektiv "experimentell" noch stark untertreiben würde. Ständig Geigen, die schrecklich schief vor sich hin sägen und bei schnelleren Szenen immer wieder ein schwer zu beschreibendes Klickerklacker. Ich bin ja offen für alles, aber schief ist schief.
Und so bleibt "There will be Blood" zwar ein Film mit hochinteressanten Ansätzen, der aber an seinem eigenen, schrecklich nervenden, Kunstwillen scheitert.
Permalink (3 Kommentare) Kommentieren
Donnerstag, 31. Januar 2008
Im Kino: Cloverfield
am Donnerstag, 31. Januar 2008, 20:59 im Topic 'Filmkritiken'
"It´s still alive!"
 Lange, lange ist es her als ich das Letzte mal den Gang ins Lichtspielhaus wagte. Nun war es endlich mal wieder so weit: "Cloverfield" stand auf dem Programm und wie ein Professioneller ging ich in die erste Vorstellung am Eröffnungstag. Ich habe versucht möglichst wenig über den Film zu lesen und das ist mir auch weitgehend gelungen, mal abgesehen von der großartigen Kritik meines Lieblings-Filmkritikers Roger Ebert. Das Einzige was zu mir durchdrang, war, dass der Film äusserst unkonventionell gedreht und storymäßig im Katastrophenfeld anzusiedeln sei. Vielleicht weil ich so wenig Vorwissen hatte, wurde ich von dem Film so erschlagen. Erschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Stammplatz ist nämlich immer im Parkett, hintenmitte (Die sogenannte "Loge" ist mir suspekt), also relativ weit vorne. Ein klarer Fehler mich dort hinzusetzen, denn den ganzen Film über wird so getan, als würde der Held mit einer Minicam selber filmen. Und das so realistisch, dass ich den ganzen Film über mit einem starken Übelkeitsgefühl zu kämpfen hatte.
Lange, lange ist es her als ich das Letzte mal den Gang ins Lichtspielhaus wagte. Nun war es endlich mal wieder so weit: "Cloverfield" stand auf dem Programm und wie ein Professioneller ging ich in die erste Vorstellung am Eröffnungstag. Ich habe versucht möglichst wenig über den Film zu lesen und das ist mir auch weitgehend gelungen, mal abgesehen von der großartigen Kritik meines Lieblings-Filmkritikers Roger Ebert. Das Einzige was zu mir durchdrang, war, dass der Film äusserst unkonventionell gedreht und storymäßig im Katastrophenfeld anzusiedeln sei. Vielleicht weil ich so wenig Vorwissen hatte, wurde ich von dem Film so erschlagen. Erschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Stammplatz ist nämlich immer im Parkett, hintenmitte (Die sogenannte "Loge" ist mir suspekt), also relativ weit vorne. Ein klarer Fehler mich dort hinzusetzen, denn den ganzen Film über wird so getan, als würde der Held mit einer Minicam selber filmen. Und das so realistisch, dass ich den ganzen Film über mit einem starken Übelkeitsgefühl zu kämpfen hatte.
Ach ja, die Kameraführung. Sagen wir es so: Die Kamera ist der Film und der Film ist die Kamera. Noch nie hat sich ein Film so stark durch das definiert, was ihn drehte. Oder zu Mindest den Anschein machen soll. Das machen die ersten Minuten einem eindrucksvoll klar. Ansonsten startet der Film extrem schwach. Etwa 20 lange Minuten werden Partygäste gefilmt, die ausschließlich den Nonsens daher labern, den 20-Jährige Yuppies halt so reden. Auffällig hier die verkrampft wirkende Jugendsprache. Wenigstens erfährt man ein wenig über die Hauptpersonen und ihre Beziehungen zueinander, dass Ganze wird aber ziemlich in die Länge gezogen. Doch als man sich gerade entspannt und die Partygespräche beginnen ins schier Endlose zu verlaufen, explodiert die heißerwartete Spannung mit einer -Ach was?- Explosion. Und dann geht alles Schlag auf Schlag: Lichter flackern, Menschen schreien und irgendwann liegt da der Kopf der Freiheitsstatue auf der Straße. Und noch mehr Menschen schreien und noch mehr Explosionen... Das einzige Konzept des Films eben. Also nochmal zum Mitschreiben: Ein Monster läuft in New York herum und zerstört alles was ihm in die Quere kommt. That´s it. Doch das soll jetzt nicht negativ klingen, ein Teil in mir schreit nämlich danach, den Film als unkonventionelles Meisterwerk abzustempeln, wahr bleibt es aber trotzdem. Der Film verläuft dann ganz klassisch nach Katastrophenfilmmuster, man beschränkt sich also auf eine Gruppe von Opfern des Desasters, die aufgrund unerwarteter Todesfälle immer weiter dezimiert wird. Dass der Film trotzdem funktioniert liegt vornehmlich an seiner Unkonventionaliät, mit der ich aber gleichzeitig den ganzen Film über kämpfen musste. Ein Score ist nicht vorhanden, der Film ist in seiner Haltung der humanisierten Kamera konsequent und die nicht sehr komplexen Figuren wachsen einem aufgrund der neuartigen Perspektive auch mehr ans Herz. Den Rest des Films also sieht man das immer kleiner werdende Grüppchen durch New York rennen, unter- und oberirdisch. Die Panik wirkt dabei aufgrund der Kamera grenzenlos nah. Ein Beispiel dafür ist die ungeheure Massenszene, bei der die Gruppe mit Tausenden anderen versucht über eine Brücke vor dem zerstörerischen Biest zu fliehen, das Monster sie aber natürlich einholt und die Brücke zerstört. Das ganze ist subtil und wuchtig zugleich. Einerseits die ungeheueren Laute des Monsters im Hintergrund und die One Man-Kamera, andererseits die atemberaubenden Spezialeffekte und die Massen an schreienden Menschen. Der Film ist wirklich ultrarealistisch, was das extreme Sounddesign unterstreicht.
Ansonsten bewegt sich der Film in der Aufarbeitung irgendwo zwischen Action und Horror, wobei Letzteres überwiegt. Das Militär und das was das Militär ausmacht kommt zwar nicht zu kurz, doch die Szenen, die eine subtil-bedrohliche Stimmung erzeugen, sind häufiger. Schuld daran sind meist die Viecher, die das Monster von sich wirft. Besonders in den Szenen, in denen die Gruppe durch einen Tunnel flüchtet, haben die kleinen Mischungen aus Krebs und Spinne ihre großen Auftritte und sind die Auslöser für einige zünftige Schockeffekte.
Etwas anderes, was über dem Film hängt wie eine dunkle Wolke der Inspiration ist ohne Zweifel 9/11. Wie "Cloverfield" das Unglück zitiert, grenzt an Geschmacklosigkeit. Staubwolken, fliehende Menschenmassen, eingestürzte Hochhäuser. Der elfte September lauert in dem Film an jeder Straßenecke. Spätestens bei den Szenen in den Notkrankenhäusern, wenn die Kamera an Massen von verstümmelten und teilweise schreienden Verletzten vorbeigleitet, dürfte jeder Amerikaner dunkle Erinnerungen bekommen.
Zum Ende hin sieht man das Monster dann immer deutlicher bis es dann zur großen Konfrontation zwischen Kamera und Monster kommt. Zumindest die Aufnahmen, die die Kamera macht, wenn sie vom Hubschrauber angeblich evakuiert wird, sind grandios. Die letzten Minuten sind dann gnadenlos pessimistisch, was mir den Film noch sympathischer machte. Als die Kamera dann allerdings einen Close-Up des Biests schießt, sieht das Monster etwa so angsteinflössend aus wie Urmel aus dem Eis. Schade, denn das war viel zu plakativ.
Was kann man nun als Fazit zu diesem aussergewöhnlichen Film sagen? Es ist mir noch nie so schwer gefallen einen Film objektiv zu bewerten, denn "Cloverfield" entzieht sich so ziemlich allen filmischen Konventionen, die Bestand haben. Auf jeden Fall war der Film eines: Sehr intensiv. Im Guten wie im Schlechten Sinne. Mir ist immer noch etwas schwindlig und das obwohl das Sehen des Films schon 3 Stunden her ist. Die totale Camcorderisierung ist zwar wie gesagt sehr bemerkenswert, ich hoffe aber das "Cloverfield" in seiner Konsequenz ein Einzelfall bleibt, denn die Wackelkamera raubt einem Film auch die echte Kinotauglichkeit, auch wenn Cloverfield aufgrund des unglaublichen Sounds im Kino trotzdem besser funktioniert. Daher die Kompromisswertung von 75% für einen Film, den man so bisher wirklich noch nicht gesehen hat.
 Lange, lange ist es her als ich das Letzte mal den Gang ins Lichtspielhaus wagte. Nun war es endlich mal wieder so weit: "Cloverfield" stand auf dem Programm und wie ein Professioneller ging ich in die erste Vorstellung am Eröffnungstag. Ich habe versucht möglichst wenig über den Film zu lesen und das ist mir auch weitgehend gelungen, mal abgesehen von der großartigen Kritik meines Lieblings-Filmkritikers Roger Ebert. Das Einzige was zu mir durchdrang, war, dass der Film äusserst unkonventionell gedreht und storymäßig im Katastrophenfeld anzusiedeln sei. Vielleicht weil ich so wenig Vorwissen hatte, wurde ich von dem Film so erschlagen. Erschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Stammplatz ist nämlich immer im Parkett, hintenmitte (Die sogenannte "Loge" ist mir suspekt), also relativ weit vorne. Ein klarer Fehler mich dort hinzusetzen, denn den ganzen Film über wird so getan, als würde der Held mit einer Minicam selber filmen. Und das so realistisch, dass ich den ganzen Film über mit einem starken Übelkeitsgefühl zu kämpfen hatte.
Lange, lange ist es her als ich das Letzte mal den Gang ins Lichtspielhaus wagte. Nun war es endlich mal wieder so weit: "Cloverfield" stand auf dem Programm und wie ein Professioneller ging ich in die erste Vorstellung am Eröffnungstag. Ich habe versucht möglichst wenig über den Film zu lesen und das ist mir auch weitgehend gelungen, mal abgesehen von der großartigen Kritik meines Lieblings-Filmkritikers Roger Ebert. Das Einzige was zu mir durchdrang, war, dass der Film äusserst unkonventionell gedreht und storymäßig im Katastrophenfeld anzusiedeln sei. Vielleicht weil ich so wenig Vorwissen hatte, wurde ich von dem Film so erschlagen. Erschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Stammplatz ist nämlich immer im Parkett, hintenmitte (Die sogenannte "Loge" ist mir suspekt), also relativ weit vorne. Ein klarer Fehler mich dort hinzusetzen, denn den ganzen Film über wird so getan, als würde der Held mit einer Minicam selber filmen. Und das so realistisch, dass ich den ganzen Film über mit einem starken Übelkeitsgefühl zu kämpfen hatte. Ach ja, die Kameraführung. Sagen wir es so: Die Kamera ist der Film und der Film ist die Kamera. Noch nie hat sich ein Film so stark durch das definiert, was ihn drehte. Oder zu Mindest den Anschein machen soll. Das machen die ersten Minuten einem eindrucksvoll klar. Ansonsten startet der Film extrem schwach. Etwa 20 lange Minuten werden Partygäste gefilmt, die ausschließlich den Nonsens daher labern, den 20-Jährige Yuppies halt so reden. Auffällig hier die verkrampft wirkende Jugendsprache. Wenigstens erfährt man ein wenig über die Hauptpersonen und ihre Beziehungen zueinander, dass Ganze wird aber ziemlich in die Länge gezogen. Doch als man sich gerade entspannt und die Partygespräche beginnen ins schier Endlose zu verlaufen, explodiert die heißerwartete Spannung mit einer -Ach was?- Explosion. Und dann geht alles Schlag auf Schlag: Lichter flackern, Menschen schreien und irgendwann liegt da der Kopf der Freiheitsstatue auf der Straße. Und noch mehr Menschen schreien und noch mehr Explosionen... Das einzige Konzept des Films eben. Also nochmal zum Mitschreiben: Ein Monster läuft in New York herum und zerstört alles was ihm in die Quere kommt. That´s it. Doch das soll jetzt nicht negativ klingen, ein Teil in mir schreit nämlich danach, den Film als unkonventionelles Meisterwerk abzustempeln, wahr bleibt es aber trotzdem. Der Film verläuft dann ganz klassisch nach Katastrophenfilmmuster, man beschränkt sich also auf eine Gruppe von Opfern des Desasters, die aufgrund unerwarteter Todesfälle immer weiter dezimiert wird. Dass der Film trotzdem funktioniert liegt vornehmlich an seiner Unkonventionaliät, mit der ich aber gleichzeitig den ganzen Film über kämpfen musste. Ein Score ist nicht vorhanden, der Film ist in seiner Haltung der humanisierten Kamera konsequent und die nicht sehr komplexen Figuren wachsen einem aufgrund der neuartigen Perspektive auch mehr ans Herz. Den Rest des Films also sieht man das immer kleiner werdende Grüppchen durch New York rennen, unter- und oberirdisch. Die Panik wirkt dabei aufgrund der Kamera grenzenlos nah. Ein Beispiel dafür ist die ungeheure Massenszene, bei der die Gruppe mit Tausenden anderen versucht über eine Brücke vor dem zerstörerischen Biest zu fliehen, das Monster sie aber natürlich einholt und die Brücke zerstört. Das ganze ist subtil und wuchtig zugleich. Einerseits die ungeheueren Laute des Monsters im Hintergrund und die One Man-Kamera, andererseits die atemberaubenden Spezialeffekte und die Massen an schreienden Menschen. Der Film ist wirklich ultrarealistisch, was das extreme Sounddesign unterstreicht.
Ansonsten bewegt sich der Film in der Aufarbeitung irgendwo zwischen Action und Horror, wobei Letzteres überwiegt. Das Militär und das was das Militär ausmacht kommt zwar nicht zu kurz, doch die Szenen, die eine subtil-bedrohliche Stimmung erzeugen, sind häufiger. Schuld daran sind meist die Viecher, die das Monster von sich wirft. Besonders in den Szenen, in denen die Gruppe durch einen Tunnel flüchtet, haben die kleinen Mischungen aus Krebs und Spinne ihre großen Auftritte und sind die Auslöser für einige zünftige Schockeffekte.
Etwas anderes, was über dem Film hängt wie eine dunkle Wolke der Inspiration ist ohne Zweifel 9/11. Wie "Cloverfield" das Unglück zitiert, grenzt an Geschmacklosigkeit. Staubwolken, fliehende Menschenmassen, eingestürzte Hochhäuser. Der elfte September lauert in dem Film an jeder Straßenecke. Spätestens bei den Szenen in den Notkrankenhäusern, wenn die Kamera an Massen von verstümmelten und teilweise schreienden Verletzten vorbeigleitet, dürfte jeder Amerikaner dunkle Erinnerungen bekommen.
Zum Ende hin sieht man das Monster dann immer deutlicher bis es dann zur großen Konfrontation zwischen Kamera und Monster kommt. Zumindest die Aufnahmen, die die Kamera macht, wenn sie vom Hubschrauber angeblich evakuiert wird, sind grandios. Die letzten Minuten sind dann gnadenlos pessimistisch, was mir den Film noch sympathischer machte. Als die Kamera dann allerdings einen Close-Up des Biests schießt, sieht das Monster etwa so angsteinflössend aus wie Urmel aus dem Eis. Schade, denn das war viel zu plakativ.
Was kann man nun als Fazit zu diesem aussergewöhnlichen Film sagen? Es ist mir noch nie so schwer gefallen einen Film objektiv zu bewerten, denn "Cloverfield" entzieht sich so ziemlich allen filmischen Konventionen, die Bestand haben. Auf jeden Fall war der Film eines: Sehr intensiv. Im Guten wie im Schlechten Sinne. Mir ist immer noch etwas schwindlig und das obwohl das Sehen des Films schon 3 Stunden her ist. Die totale Camcorderisierung ist zwar wie gesagt sehr bemerkenswert, ich hoffe aber das "Cloverfield" in seiner Konsequenz ein Einzelfall bleibt, denn die Wackelkamera raubt einem Film auch die echte Kinotauglichkeit, auch wenn Cloverfield aufgrund des unglaublichen Sounds im Kino trotzdem besser funktioniert. Daher die Kompromisswertung von 75% für einen Film, den man so bisher wirklich noch nicht gesehen hat.
Permalink (11 Kommentare) Kommentieren
Samstag, 22. Dezember 2007
Ich kanns nicht lassen
am Samstag, 22. Dezember 2007, 18:03 im Topic 'Filmkritiken'
Das muss einfach nochmal gepostet werden: Hell, Yeah! Hellboy II: The Golden Army trailer
Auch wenn ich den Trailer jetzt bestimmt schon an die 10 mal gesehen habe, muss jedesmal breit grinsen vor Freude wenn Perlman zu diesem Black Metal-Fuzzi sagt: "So why don´t you just start with me?!". Genauso großartig der klassische Hellboy-Moment wo Perlman den geilen Oneliner "Now you really pissed me off!" bringt. Eine üble Frechheit ist es übrigens, dass der deutsche Verleih den Film erst zwei (!) Monate nach dem US-Start in die Kinos bringt. Vielleicht komme ich ja irgendwie in die Premiere...
Auch wenn ich den Trailer jetzt bestimmt schon an die 10 mal gesehen habe, muss jedesmal breit grinsen vor Freude wenn Perlman zu diesem Black Metal-Fuzzi sagt: "So why don´t you just start with me?!". Genauso großartig der klassische Hellboy-Moment wo Perlman den geilen Oneliner "Now you really pissed me off!" bringt. Eine üble Frechheit ist es übrigens, dass der deutsche Verleih den Film erst zwei (!) Monate nach dem US-Start in die Kinos bringt. Vielleicht komme ich ja irgendwie in die Premiere...
Permalink (4 Kommentare) Kommentieren
Dienstag, 20. November 2007
Im Kino: American Gangster
am Dienstag, 20. November 2007, 19:08 im Topic 'Filmkritiken'
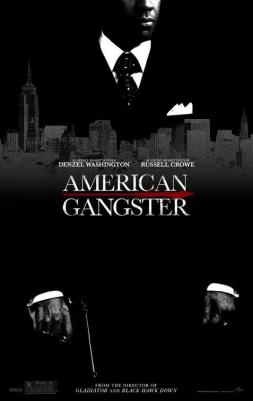 Es gibt Filme, die an ihrer Perfektheit scheitern. Zumindest teilweise gehört "American Gangster" zu dieser Art. Ein ohne Zweifel guter Film mit guter Kameraarbeit, funkigem Soundtrack, spannender Inszenierung, einer interessanten Geschichte und großen Charakterdarstellern. Trotzdem will der Funke nie so wirklich überspringen.
Es gibt Filme, die an ihrer Perfektheit scheitern. Zumindest teilweise gehört "American Gangster" zu dieser Art. Ein ohne Zweifel guter Film mit guter Kameraarbeit, funkigem Soundtrack, spannender Inszenierung, einer interessanten Geschichte und großen Charakterdarstellern. Trotzdem will der Funke nie so wirklich überspringen. Der Film dreht sich um zwei Hauptpersonen, die eine ist der von Denzel Washington gespielte aufsteigende Mafiaboss Frank Lucas, die andere der von Russel Crowe verkörperte Cop Richie Roberts. Letzterer ist der klassische Held von Polizeifilmen der 70er. Ein idealistischer, unbestechlicher Einzelgänger, dessen Glaube an Recht und Ordnung nie versiegt. Kein sehr origineller Charakter und so bleibt Russel Crows Figur meist blass und wird teilweise von Denzel Washington an die Wand gespielt. Frank Lucas revolutionierte zur Zeit des Vietnam-Krieges den amerikanischen Drogenhandel, indem er direkt von der Quelle in Särgen gefallener Marines hunderprozentig reines Kokain in die Staaten schmuggelte. Denzel Washington ist die perfekte Besetzung für Frank Lucas, denn er neigt ja eher zu etwas ruhigerem und umso intenisiverem Spiel. Wie schrecklich wäre der Film geworden, hätte man eine schwarze Version von Jack Nicholson als Mafiaboss genommen. Washington spielt Lucas als Traditionalisten und Familenmensch. Bescheiden, aber sehr ehrgeizig. Ein durch und durch sympathischer Charakter, wäre er ein ganz normaler amerikanischer Geschäftsmann. Das ist aber nicht der Fall, denn Frank Lucas ist ein kaltblütiger Führer eines riesigen Drogenimperiums und gleich am Anfang sieht man ihn, wie er einen Menschen verbrennen lässt. Eine interessante Figur, doch wirkt es teilweise etwas klischeelastig wie sein Familienleben aufgearbeitet wird. Besonders die Konflikte mit seiner Mutter und seiner Frau wirken teilweise wie aus einer Vorabendserie und sind unnötig pathetisch wie einfallslos. Sehr intensiv und spannend hingegen ist die Beschreibung der schwarzen Gangster-Society.
Woran der Film aber besonders krankt ist die fehlende Fallhöhe. Der Konflikt zwischen Richie Roberts und Frank Lucas wird erst gegen Ende wahrnehmbar, zu lange laufen die beiden Handlungststränge nebeneinander her ohne etwas miteinander zu tun zu haben. Außerdem lässt sich der Film etwas zu viel Zeit bei der Beschreibung des Aufstiegs Lucas`, denn es ist immer uninteressanter einem gewinnenden Charakter zuzugucken, als einem verlierenden. Die wirklich intensiven Szenen kommen erst als Frank Lucas Imperium und Lucas selber erst ins Wanken geraten und schließlich stürzen. Hierbei ist die wunderbar inszenierte Verhaftung Lucas´ vor einer Kirche besonders hervorzuheben.
Was aber dem Film fehlt ist das gewisse Etwas, das i-Tüpfelchen. Die Inszenierung ist zwar wunderbar, aber nie wirklich rauh und eigenartig kantenlos. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass im Film vollkommen zusammenhanglos Schockbilder von sich zu dröhnenden Drogenwracks gezeigt werden. Nur um das schlechte Gewissen zu mindern, dass die Macher wohl hatten, weil sich ihre Inszenierung so auf das harmonische Familienleben der sympathischen Figur des Frank Lucas konzentriert. In Wahrheit ist diese Maßnahme viel zu plakativ und spießig. Auch ansonsten fehlt das echt Innovative und so bleibt "American Gangster" zwar ein sehr guter Film, aber ein Klassiker wird er nicht werden.
Deswegen ambitionierte:
75%
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Sonntag, 28. Oktober 2007
Im Kino: Die Ermordung Jesse James durch den Feigling Robert Ford
am Sonntag, 28. Oktober 2007, 01:10 im Topic 'Filmkritiken'
 Heute war ich das erste Mal meinem Multiplex-Kino dankbar, dass es so viel Werbung zeigt, denn obwohl ich Sage und Schreibe eine halbe Stunde zu spät war, verpasste ich nur die ersten paar Minuten.
Heute war ich das erste Mal meinem Multiplex-Kino dankbar, dass es so viel Werbung zeigt, denn obwohl ich Sage und Schreibe eine halbe Stunde zu spät war, verpasste ich nur die ersten paar Minuten. "Die Ermordung Jessie James..." ist der Auftakt für ein sehr erfreuliches Westernrevival in den Kinos. Am 13. Dezember erscheint in den deutschen Kinos "Todeszug nach Yuma", ein Edelwestern mit Russel Crowe. Doch der Trailer lässt einen ganz anderen Film vermuten wie es der Film mit dem unendlich langen Titel und Brad Pitt in der Hauptrolle ist. Der ist nämlich kein Western im Sinne von in den Sonnenuntergang reitenden Outlaws, wilden Feuergefechten und bösen Indianern.
Jesse James war einer der ersten amerikanischen Medienstars, vom Staat wegen seiner Verbrechen gesucht, vom Volk aber wie ein Gott verehrt. Und da ist es doch nur passend das Brad Pitt eben diesen spielt, der schließlich in letzter Zeit oft seltener wegen seiner Filme als wegen seiner Boulevardstories auffiel. Der Film scheint eine echte Herzensangelegenheit Pitts zu sein, auch weil er in der letzten halben Stunde immer mehr das Feld des klassischen Westerns verlässt und zur kongenialen Parabel für die Verehrung und Verachtung Prominenter und die Sehnsucht nach Ruhm wird. Pitt spielt den Jesse James großartig als ein Mythos, den seine Prominenz auffrisst, wird aber teilweise von Ben Afflecks weniger bekannten Bruder Casey an die Wand gespielt. Sein recht undankbarer Part als "Feigling" Robert Ford meistert er oft noch besser als Pitt. Alles andere als ein sympathischer Charakter, trotzdem spielt er den krankhaften Verehrer des Westernmythos mit viel Leidenschaft. Robert Ford ist in jeder Hinsicht der Gegenpart zu Jesse James: Ford ist ein Schwächling, der glaubt, er sei für etwas Großes bestimmt, während Jesse James eine Ikone ist, der daran zerbricht, dass er zwar nur von Verehrern umgeben ist, sich selber aber seiner Schwäche bewusst ist. Zwischen Casey Affleck und Brad Pitt herrscht eine fast erotische Spannung, von der sich der Verehrer am Ende durch den Mord emanzipiert.
Der Film setzt, nach einem kleinen Prolog zur Biografie Jesse James, bereits kurz vor dem Ende des Untergangs der James-Bande ein. Jesse und sein Vater sind sichtlich angeschlagen und die Truppe besteht hauptsächlich aus debilen Nichtsnutzen, weil die ursprüngliche Bande tot oder im Gefängnis ist. Ein klassischer Zugüberfall beginnt und man wähnt sich in der Illusion einem klassischen Western mit erschreckten Passagieren und fluchenden Gaunern beizuwohnen. Es dauert aber nicht lange und schon ist man mitten drin in einem der unendlich langen Gespräche, die typisch für den Film sind. Leider besteht der Film im Mittelteil fast nur aus unendlich langen Dialogen und extrem elegischen Szenen. Ich habe nichts gegen lange, ruhige Szenen, solange sie eine gewisse Dynamik haben. Leider ist das bei dem Film fast nie der Fall, denn er reiht nichtssagende und für die Handlung des Films sowie für die Charaktere unwichtige Szenen aneinander und so verliert man schnell das Interesse. Das Schlimme ist, dass der Film im Grunde keinen Spannungsbogen hat, er nimmt nie Fahrt auf und verliert deswegen auch nie an Spannung. Es ist nichts gegen eine langsame Erzählweise einzuwenden, solange man in den einzelnen Szenen eine gewisse Anspannung erhält, was "Die Ermordung Jesse James..." durch seine langweiligen Dialoge und seine ermüdende Inszenierung aber verspielt. Das einzige was den Film vor der totalen Langeweile rettet ist sein auch in den Nebenfiguren großartiger Cast.
Das wirklich innovative an dem Film aber ist seine neue, nicht so verklärte Sichtweise auf den wilden Westen. Kameralegende Roger Deakins (der in fast jedem guten Film seine Finger drin hat) erzeugt eine atemberaubende Bildsprache und eine ungeheure Authenzität. Nie hat man eine so real wirkende Darstellung des "wilden Westens" im Kino gesehen. Das unterstreicht auch der ebenso gelunge Soundtrack, eine Kostprobe gibt es auf der offiziellen Filmseite, der viele Komponente alter amerikanischer Musik in sich vereint.
Und so stehe ich "The Assasination of Jesse James by the Coward Robert Ford" zwiespältig gegenüber, einerseits überwältigt von der Bildsprache und dem Cast, anderseits gelangweilt von der biederen Inszenierung.
60%
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Donnerstag, 25. Oktober 2007
Im Kino: Auf der anderen Seite
am Donnerstag, 25. Oktober 2007, 15:55 im Topic 'Filmkritiken'
 Nach dem schrecklich überschätzten Betroffenheitsfilm "Das Leben der Anderen" nun also noch ein deutscher Film mit einem "Anderen" im Titel. "Auf der anderen Seite" ist aber bei weitem der bessere Film und eine Oscar-Nominierung würde ich ihm von Herzen gönnen.
Nach dem schrecklich überschätzten Betroffenheitsfilm "Das Leben der Anderen" nun also noch ein deutscher Film mit einem "Anderen" im Titel. "Auf der anderen Seite" ist aber bei weitem der bessere Film und eine Oscar-Nominierung würde ich ihm von Herzen gönnen. Trotzdem ist es eigentlich ein bisschen schade, dass deutsche Regiesseure anscheinend nur melodramatische Sachen drehen können. Fatih Akins Episodenfilm gehört aber eindeutig zu den besseren Vertretern, die verschiedenen Geschichten rundum die Nähe und Ferne zweier Länder werden sehr besonnen erzählt und jede Figur hat genug Platz für sich. Schön ist auch, dass Akin jeder Art von Pathos aus dem Weg geht, was den Film allerdings teilweise etwas anstrengend macht. Die Plotlinien wirken zudem teilweise sehr konstruiert und unecht, gelegentlich hat die Geschichte etwas von einer biblischen Erzählung und ein bisschen göttlich fühlt sich der Zuschauer auch. Er betrachtet das Geschehen relativ kühl von einer höheren Perspektive aus, was bei den ineinander verwobenen Geschichten gar nicht anders möglich ist. Trotzdem bietet der Film einige sehr schöne Momente, so ist unter anderem das Schlußbild des am Strand sitzenden Mannes sehr gelungen und der Film wirkt wegen seiner Figuren noch lange nach.
78%
Permalink (1 Kommentar) Kommentieren
... ältere Einträge
